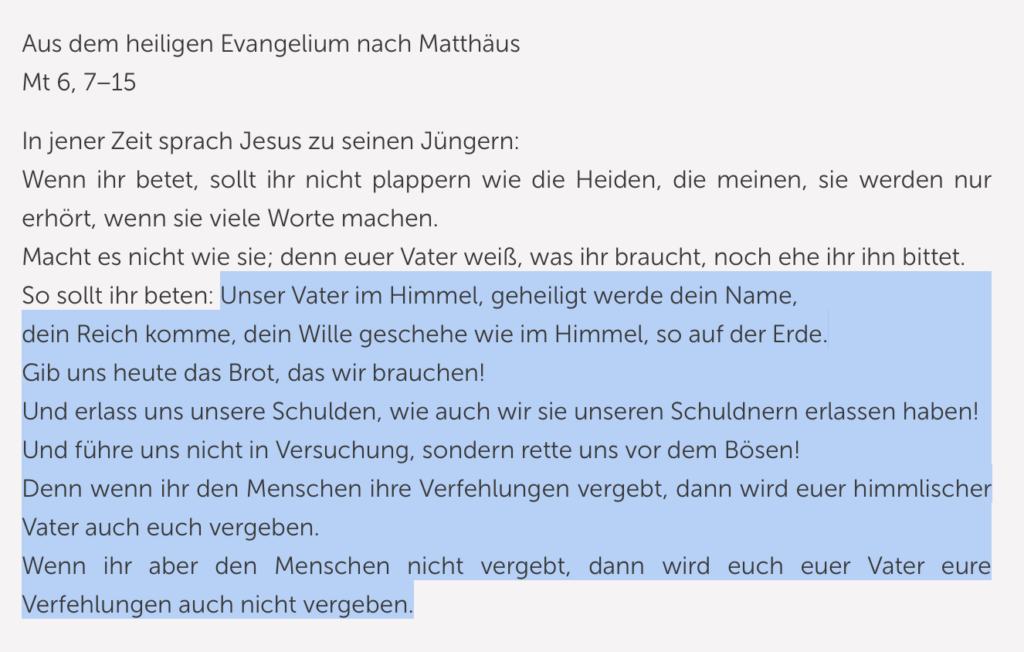Fastentuch von Michael Hedwig in der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz
Fastenzeit 2025

Fastentuch von Michael Hedwig in der Pfarrkirche St. Andrä (2025 ausgestellt)
Quelle: https://www.hedwig.at/fastentuch/
Seit dem Mittelalter gibt es den Brauch, in der Fastenzeit den Hochaltar, einzelne Bilder oder die Kreuze zu verhüllen. Die großen Fastentücher im Altarraum erinnern an einen Vorhang, der zum Ausdruck der Trauer über den Tod Jesu den Hochaltar verhüllt.
Manchmal werden schlichte einfärbige Tücher – meist in der Farbe Violett – verwendet, ab und zu – z.B. mehrfach in Kärnten – zeigen die Fastentücher ein reiches biblisches Bildprogramm von der Erschaffung der Welt bis zu Tod und Auferstehung Jesu. Das Schloss Bruck besitzt das wertvolle Virgener Fastentuch (5×8 m) aus dem Jahr 1598.
In der Fastenzeit 2025 wird zum zweiten Mal nach 2024 im Altarraum unserer Pfarrkirche St. Andrä ein besonderes Fastentuch hängen und absichtlich den Blick auf den Hochaltar verdecken. Dieses wurde vom Lienzer Künstlers Michael Hedwig im Jahr 2010 als Auftragswerk der Dompfarre Innsbruck und der Initiative Kunstraum Kirche geschaffen. Es hat eine Größe von 11x7m und ist mit Acryl auf drei Bahnen ungrundierter Baumwolle gemalt. In der Fastenzeit 2010 und 2011 hing dieses Fastentuch im Dom zu Innsbruck und in den Jahren 2020-2023 in der Michaelerkirche Wien.
Auferweckung der Gebeine und Verklärung Jesu
Die Darstellung am Fastentuch von Michael Hedwig verbindet zwei biblische Motive: die Vision des Propheten Ezechiel, der schildert, wie tote Gebeine aus der Erde herauskommen und vom Geist Gottes zu neuem Leben erweckt werden (Ezechiel Kapitel 37), und die Verklärung Jesu, die alljährlich in der Kirche am 2. Fastensonntag als Evangelium verkündet wird. Eine Darstellung der Vision Ezechiels befindet sich im Eingangsraum der Pfarrkirche St. Andrä. Mit dem gegenüberliegenden Bild der Auferweckung des Lazarus verkündet diese bereits im Eingangsbereich der Kirche die Botschaft von der Auferstehung.
Das Fastentuch von Michael Hedwig ist auf vier Etagen gegliedert: Unten steigen aus den Gräbern die Gebeine der Toten heraus, sie werden Menschen mit Fleisch und vor allem mit Herz. Der verklärte Christus auf der obersten Etage zieht sie gleichsam nach oben. Sein verherrlichter Leib und die Fähigkeit, Menschen nach oben zu ziehen, erinnert bereits an die Auferstehung. Die geschichtlichen Katastrophen der Sklaverei des Volkes Israel in Ägypten, dessen Exils in Babylon und das Kreuz vom Karfreitag werden dadurch nicht verhindert, aber stehen unter dem Vorzeichen der Hoffnung auf Erlösung. Der blaue Farbton am Fastentuch ganz oben und das Weiß des verklärten Jesus drücken die Dimension des Ewigen aus, der braune Farbton am unteren Ende des Fastentuches erinnert an das Erdhafte unseres Lebens.
Die Lichtfülle, die an schönen Tagen durch den Altarraum von St. Andrä flutet, lässt die Details noch mehr in ein verklärtes Licht treten und verstärkt diesen Effekt umso mehr.
Michael Hedwig
Das Fastentuch von Michael wirkt wie eine ruhige feierliche Komposition, in der die Figuren wie auf einer transzendenten Bühne erscheinen. Das Leitthema „Körper“ begleitet das Wirken von Michael Hedwig schon seit Jahrzehnten.
Michael Hedwig wurde 1957 in Lienz in der Friedensiedlung geboren. 1974–1980 absolvierte er sein Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Von 1985 bis 2022 war er Lehrender an der Akademie der bildenden Künste Wien, als Assistenzprofessor leitete er seit 1998 die Tiefdruckwerkstatt am Institut für bildende Kunst. Sein Atelier betreibt er im Bezirk Mariahilf in Wien. Sein vielfältiges Schaffen belegen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sowie Arbeiten im öffentlichen Raum, u. a. die Gestaltung der U3-Station Stubentor im 1. Bezirk Wien.
Predigt von Dekan Dr. Franz Troyer und Schriftstelle auf der Homepage der Pfarre Lienz St. Andrä.
Deckenfresko in der Altmannikrypta von Stift Göttweig

Martin Johann Schmidt: Die Auferweckungsvision des Propheten Ezechiel, Deckenfresko in der Krypta der Stiftskirche Göttweig, um 1770, Ez 37,1–6
Dieser Artikel ist noch nicht fertig.
Ich möchte auch noch die Auferstehung des Lazarus einarbeiten.
Gedanken dazu:
https://www.erzdioezese-wien.at/dl/qnrlJKJnKOmOJqx4KJK/SON_5_FaSo_2020_pdf