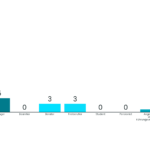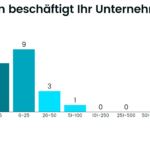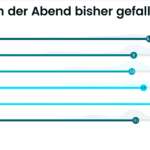Liebe und Verlust: Hannah Arendt und der fundamentale Schrecken des Verlusts
Eine kleine Nachlese bei Hannah Arendt und Augustinus von Harald Preyer
Wien, am 2.6.2024
„Liebe, aber sei vorsichtig, was du liebst“, schrieb der römisch-afrikanische Philosoph Augustinus in den letzten Jahren des vierten Jahrhunderts. In gewisser Weise sind wir das, was wir lieben – wir werden es, so wie es uns wird, heraufbeschworen aus unseren unzähligen bewussten und unbewussten Sehnsüchten, Verzweiflungen und Mustern der Begierde. Dennoch ist da etwas zutiefst Paradoxes in dem Aufruf zur Vernunft in der Vorstellung, dass wir Vorsicht walten lassen können in Liebesangelegenheiten – geliebt zu haben bedeutet, das Korsett der Irrationalität zu kennen, das selbst über den willensstärksten Verstand schlüpft, wenn das Herz mit seiner köstlichen Sorglosigkeit übernimmt.
Wie man Augustinus‘ Vorsicht beherzigt, nicht durch Unterwerfung, sondern durch besseres Verständnis unserer Erfahrung der Liebe, erforscht Hannah Arendt (14. Oktober 1906 – 4. Dezember 1975) in ihrem wenig bekannten, aber in vieler Hinsicht schönsten Werk, „Liebe und Augustinus“ – Arendts erstes Buchmanuskript und das letzte, das auf Englisch veröffentlicht wurde, posthum gerettet aus ihren Papieren von der Politikwissenschaftlerin Joanna Vecchiarelli Scott und der Philosophin Judith Chelius Stark.
In den fünf Jahrzehnten, nachdem sie es 1929 als ihre Doktorarbeit geschrieben hatte – eine Zeit, in der diese Apostelin der Vernunft, die eine der schärfsten und kühlsten analytischen Köpfe des zwanzigsten Jahrhunderts werden sollte, ihre feurigen Liebesbriefe an Martin Heidegger verfasste – überarbeitete und annotierte Arendt das Manuskript obsessiv. An Augustinus‘ Schleifstein schärfte sie ihre zentralen philosophischen Ideen – hauptsächlich die problematische Diskrepanz, die sie zwischen Philosophie und Politik sah, wie sie durch den Aufstieg von Ideologien wie dem Totalitarismus belegt wurde, dessen Ursprünge sie so denkwürdig und eindringlich untersuchte. Von Augustinus übernahm sie den Ausdruck amor mundi – „Liebe zur Welt“ –, der ein prägendes Merkmal ihrer Philosophie werden sollte. Beschäftigt mit Fragen, warum wir dem Bösen erliegen und es normalisieren, identifizierte Arendt als Wurzel der Tyrannei den Akt, andere Menschen irrelevant zu machen. Immer wieder kehrte sie zu Augustinus für das Gegenmittel zurück: die Liebe.
Doch während diese alte Vorstellung von Nächstenliebe, die Martin Luther King, Jr. inspirieren sollte, zentral für Arendts philosophische Besorgnis und ihr Interesse an Augustinus war, ist ihre politische Bedeutung untrennbar von der tiefsten Quelle der Liebe: dem Persönlichen. Bei all der politischen und philosophischen Weisheit, die sie daraus zieht, wird Augustinus‘ „Bekenntnisse“ von seiner Erfahrung persönlicher Liebe belebt – jene ewige Kraft, die die Sonne und den Mond und die Sterne unserer inneren Leben regiert, reflektiert und kodifiziert in unseren kulturellen und sozialen Strukturen.
Mit einem Auge auf Augustinus‘ Vorstellung von Liebe als „eine Art Verlangen“ – das lateinische appetitus, von dem sich das Wort „Appetit“ ableitet – und seiner Behauptung, dass „lieben in der Tat nichts anderes ist als etwas um seiner selbst willen zu begehren“, betrachtet Arendt dieses richtungsweisende Verlangen, das die Liebe antreibt:
„Jedes Verlangen ist an ein bestimmtes Objekt gebunden, und es bedarf dieses Objekts, um das Verlangen selbst zu entfachen und ihm somit ein Ziel zu geben. Das Verlangen wird durch das bestimmte Gegebene bestimmt, das es sucht, so wie eine Bewegung durch das Ziel bestimmt wird, auf das sie sich zubewegt. Denn, wie Augustinus schreibt, ist Liebe ‚eine Art Bewegung, und jede Bewegung ist auf etwas gerichtet‘. Was die Bewegung des Begehrens bestimmt, ist immer zuvor gegeben. Unser Verlangen zielt auf eine Welt, die wir kennen; es entdeckt nichts Neues. Das, was wir kennen und begehren, ist ein ‚Gut‘, andernfalls würden wir es nicht um seiner selbst willen suchen. Alle Güter, die wir in unserer suchenden Liebe begehren, sind unabhängige Objekte, die in keiner Beziehung zu anderen Objekten stehen. Jedes von ihnen stellt nichts anderes dar als seine isolierte Güte. Das charakteristische Merkmal dieses Gutes, das wir begehren, ist, dass wir es nicht haben. Sobald wir das Objekt haben, endet unser Verlangen, es sei denn, wir sind von seinem Verlust bedroht. In diesem Fall verwandelt sich das Verlangen zu haben in die Angst zu verlieren. Als Suche nach dem bestimmten Gut statt nach zufälligen Dingen ist das Begehren eine Kombination aus ‚Zielen auf‘ und ‚Zurückverweisen auf‘. Es verweist zurück auf den Einzelnen, der das Gute und Böse der Welt kennt und glücklich leben will. Es ist, weil wir das Glück kennen, dass wir glücklich sein wollen, und da nichts sicherer ist als unser Wunsch, glücklich zu sein, leitet uns unsere Vorstellung von Glück bei der Bestimmung der jeweiligen Güter, die dann zu Objekten unserer Begierden werden. Verlangen oder Liebe ist die menschliche Möglichkeit, das Gut zu erlangen, das ihn glücklich machen wird, das heißt, das zu erlangen, was ihm am meisten eigen ist.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Deshalb kann eine großzügige und unbesitzergreifende Liebe – eine Liebe, die durch das Scheitern, das begehrte Gut zu erlangen, nicht vermindert wird – wie eine Leistung erscheinen, die nichts weniger als übermenschlich ist. („Wenn gleiche Zuneigung nicht sein kann, / Lass mich der liebevollere sein“, schrieb Arendts guter Freund und großer Bewunderer W.H. Auden in seiner erhabenen Ode an diesen übermenschlichen Triumph des Herzens.) Aber eine Liebe, die auf Besitz basiert, warnt Arendt, verwandelt sich unvermeidlich in Angst – die Angst, das Gewonnene zu verlieren. Zwei Jahrtausende nachdem Epiktet seine Heilung für Liebeskummer im Akzeptieren, dass alle Dinge vergänglich sind und daher auch die Liebe mit den losen Fingern der Nicht-Anhaftung gehalten werden sollte, angeboten hatte, schreibt Arendt – die Augustinus‘ Schuld an den Stoikern bemerkt:
„Solange wir zeitliche Dinge begehren, sind wir ständig dieser Bedrohung ausgesetzt, und unsere Angst zu verlieren entspricht immer unserem Wunsch zu haben. Zeitliche Güter entstehen und vergehen unabhängig vom Menschen, der durch sein Begehren an sie gebunden ist. Ständig durch Verlangen und Angst an eine Zukunft voller Ungewissheiten gebunden, berauben wir jeden gegenwärtigen Moment seiner Ruhe, seines intrinsischen Wertes, den wir nicht genießen können. Und so zerstört die Zukunft die Gegenwart.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Ein halbes Jahrhundert nach Tolstois Ermahnung, dass „zukünftige Liebe nicht existiert [denn] Liebe ist nur eine gegenwärtige Aktivität“, fügt Arendt hinzu:
„Die Gegenwart wird nicht durch die Zukunft als solche bestimmt… sondern durch bestimmte Ereignisse, die wir von der Zukunft hoffen oder fürchten, und die wir entsprechend begehren und verfolgen oder meiden und vermeiden. Glück besteht im Besitz, im Haben und Halten unseres Gutes, und noch mehr darin, sicher zu sein, es nicht zu verlieren. Traurigkeit besteht darin, unser Gut verloren zu haben und diesen Verlust zu ertragen. Doch für Augustinus wird das Glück des Habens nicht von der Traurigkeit, sondern von der Angst des Verlusts kontrastiert. Das Problem des menschlichen Glücks ist, dass es ständig von Angst heimgesucht wird. Es geht nicht um das Fehlen des Besitzes, sondern um die Sicherheit des Besitzes.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Der Tod ist natürlich der ultimative Verlust – sowohl der Liebe als auch des Lebens – und daher das ultimative Objekt unserer zukunftsorientierten Angst. Und doch ist diese Flucht vor der Gegenwart durch das Portal der Angst – vielleicht die häufigste Krankheit, der Menschen unterliegen – selbst ein lebender Tod. Arendt schreibt:
„In ihrer Angst vor dem Tod fürchten diejenigen, die leben, das Leben selbst, ein Leben, das zum Sterben verurteilt ist… Die Weise, in der das Leben sich selbst kennt und wahrnimmt, ist Sorge. So wird das Objekt der Angst zur Angst selbst. Selbst wenn wir annehmen sollten, dass es nichts zu fürchten gibt, dass der Tod kein Übel ist, bleibt die Tatsache der Angst (dass alle Lebewesen den Tod scheuen).“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Vor diesem Hintergrund des negativen Raums zeichnet Arendt die Form des ultimativen Objekts der Liebe nach Augustinus:
„Furchtlosigkeit ist, was die Liebe sucht. Liebe als Verlangen wird durch ihr Ziel bestimmt, und dieses Ziel ist Freiheit von Angst.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
In einem Gefühl, das den zentralen Mechanismus beleuchtet, durch den Frustration (vorübergehende) Zufriedenheit in der romantischen Liebe befeuert, fügt sie hinzu:
„Eine Liebe, die etwas Sicheres und Verfügbares auf der Erde sucht, ist ständig frustriert, weil alles dem Untergang geweiht ist. In dieser Frustration kehrt sich die Liebe um und ihr Objekt wird eine Negation, so dass nichts mehr begehrt wird außer Freiheit von Angst. Eine solche Furchtlosigkeit existiert nur in der völligen Ruhe, die nicht mehr durch erwartete Ereignisse der Zukunft erschüttert werden kann.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Wenn Gegenwart – das Entfernen von Erwartungen – eine Voraussetzung für eine wahre Erfahrung der Liebe ist, dann ist Zeit die elementare Infrastruktur der Liebe. Fast ein halbes Jahrhundert später, als sie die erste Frau wurde, die in der 85-jährigen Geschichte der Gifford Lectures die prestigeträchtige Vorlesungsreihe hielt, würde Arendt diese Vorstellung von Zeit als den Ort unseres denkenden Egos zum Mittelpunkt ihres bahnbrechenden Vortrags „Das Leben des Geistes“ machen. Nun, indem sie aus Augustinus‘ Schriften zitiert, betrachtet sie das Paradoxon der Liebe jenseits der Zeit für Geschöpfe, die so zeitlich sind wie wir:
„Selbst wenn die Dinge bestehen bleiben sollten, tut es das menschliche Leben nicht. Wir verlieren es täglich. Während wir leben, ziehen die Jahre durch uns hindurch und sie nagen uns zu Nichts. Es scheint, dass nur die Gegenwart real ist, denn ‚vergangene und zukünftige Dinge sind nicht‘; aber wie kann die Gegenwart (die ich nicht messen kann) real sein, da sie keinen ‚Raum‘ hat? Das Leben ist immer entweder nicht mehr oder noch nicht. Wie die Zeit kommt das Leben ‚aus dem Noch-nicht, geht durch das Ohne-Raum, und verschwindet in das Nicht-mehr‘. Kann man sagen, dass das Leben überhaupt existiert? Dennoch misst der Mensch die Zeit. Vielleicht besitzt der Mensch einen ‚Raum‘, in dem die Zeit lange genug bewahrt werden kann, um gemessen zu werden, und würde dieser ‚Raum‘, den der Mensch mit sich trägt, nicht sowohl das Leben als auch die Zeit übersteigen?“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Zeit existiert nur, insofern sie gemessen werden kann, und der Maßstab, mit dem wir sie messen, ist der Raum.
Für Augustinus, merkt sie an, ist das Gedächtnis der Raum, in dem die Zeit gemessen und gespeichert wird:
„Das Gedächtnis, das Lagerhaus der Zeit, ist die Gegenwart des ‚Nicht-mehr‘ (iam non), wie die Erwartung die Gegenwart des ‚Noch-nicht‘ (nondum) ist. Daher messe ich nicht das, was nicht mehr ist, sondern etwas in meinem Gedächtnis, das darin fixiert bleibt. Es ist nur durch die Herbeirufung der Vergangenheit und Zukunft in die Gegenwart des Erinnerns und Erwartens, dass die Zeit überhaupt existiert. Daher ist die einzige gültige Zeitform die Gegenwart, das Jetzt.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Eines der großen Themen, die ich in Figuring untersuche, ist diese Frage der Zeitlichkeit selbst unserer üppigsten Erfahrungen. „Die Vereinigung zweier Naturen für eine Zeit ist so groß“, schrieb Margaret Fuller – eine meiner zentralen Figuren. Sollen wir verzweifeln oder uns freuen über die Tatsache, dass selbst die größten Lieben nur „für eine Zeit“ existieren? Die Zeitskalen sind elastisch, sie dehnen und kontrahieren sich mit der Tiefe und Größe jeder Liebe, aber sie sind immer endlich – wie Bücher, wie Leben, wie das Universum selbst. Der Triumph der Liebe liegt im Mut und der Integrität, mit der wir die transzendente Vergänglichkeit bewohnen, die zwei Menschen für die Zeit bindet, in der sie gebunden sind, bevor sie mit gleichem Mut und Integrität loslassen. Fullers Ausruf beim ersten Anblick der Gemälde von Correggio, überwältigt von einer Schönheit, die sie zuvor nicht gekannt hatte, strahlt eine größere Wahrheit über das menschliche Herz aus: „Süße Seele der Liebe! Auch von dir würde ich müde werden; aber es war glorreich an jenem Tag.“
Arendt verortet diese grundlegende Tatsache des Herzens in Augustinus‘ Schriften. Ein Jahrhundert nachdem Kierkegaard behauptete, dass „der Augenblick nicht richtig ein Atom der Zeit, sondern ein Atom der Ewigkeit ist“, stellt sie fest:
„Das Jetzt ist das, was die Zeit rückwärts und vorwärts misst, weil das Jetzt, streng genommen, nicht die Zeit ist, sondern außerhalb der Zeit. Im Jetzt treffen Vergangenheit und Zukunft aufeinander. Für einen flüchtigen Moment sind sie gleichzeitig, so dass sie vom Gedächtnis gespeichert werden können, das sich an Vergangenes erinnert und die Erwartung von Zukünftigem hält. Für einen flüchtigen Moment (das zeitliche Jetzt) ist es, als würde die Zeit stillstehen, und es ist dieses Jetzt, das Augustinus‘ Modell der Ewigkeit wird.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Augustinus selbst erfasst diese transzendente Zeitlichkeit:
„Wer wird [das Herz] halten und fixieren, damit es einen Moment stillsteht und für einen Moment den Glanz der Ewigkeit einfängt, die für immer stillsteht, und dies mit zeitlichen Momenten vergleicht, die niemals stillstehen, und sieht, dass es unvergleichlich ist… aber dass in dieser Ewigkeit nichts vergeht, sondern das Ganze präsent ist.“ (Augustinus)
Arendt schärft den Kern des Paradoxons:
„Was den Menschen daran hindert, im zeitlosen Jetzt zu ‚leben‘, ist das Leben selbst, das niemals ’stillsteht‘. Das Gute, nach dem die Liebe verlangt, liegt jenseits aller bloßen Wünsche. Wenn es nur eine Frage des Begehrens wäre, würden alle Wünsche in Angst enden. Und da alles, was das Leben von außen als Objekt seines Begehrens konfrontiert, um des Lebens willen gesucht wird (ein Leben, das wir verlieren werden), ist das ultimative Objekt aller Wünsche das Leben selbst. Das Leben ist das Gut, das wir suchen sollen, nämlich das wahre Leben.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Sie kehrt zum Begehren zurück, das uns gleichzeitig aus dem Leben herausführt und in es hinein stürzt:
„Das Begehren vermittelt zwischen Subjekt und Objekt, und es vernichtet die Distanz zwischen ihnen, indem es das Subjekt in einen Liebenden und das Objekt in das Geliebte verwandelt. Denn der Liebende ist niemals isoliert von dem, was er liebt; er gehört dazu… Da der Mensch nicht selbstgenügsam ist und daher immer etwas außerhalb seiner selbst begehrt, kann die Frage, wer er ist, nur durch das Objekt seines Begehrens und nicht, wie die Stoiker dachten, durch die Unterdrückung des Begehrens selbst gelöst werden: ‚So ist jeder, wie seine Liebe ist‘ [schrieb Augustinus]. Streng genommen ist er, der überhaupt nicht liebt und begehrt, ein Niemand.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
[…]
„Der Mensch als solcher, sein Wesen, kann nicht definiert werden, weil er immer danach strebt, zu etwas außerhalb seiner selbst zu gehören und sich entsprechend verändert… Wenn er überhaupt eine wesentliche Natur haben könnte, wäre es der Mangel an Selbstgenügsamkeit. Daher wird er durch Liebe angetrieben, aus seiner Isolation auszubrechen… für das Glück, das die Umkehrung der Isolation ist, ist mehr erforderlich als bloßes Zugehören. Glück wird nur erreicht, wenn das Geliebte ein dauerhaftes inhärentes Element des eigenen Seins wird.“ (Hannah Arendt, Liebe und Augustinus)
Es ist erstaunlich, die Linie dieser Ideen im Leben von Arendts Denken zu verfolgen. Jahrzehnte nach ihren Doktortagen würde sie ihre einflussreiche Abhandlung darüber verfassen, wie Tyrannen Isolation als Waffe der Unterdrückung verwenden – Totalitarismus ist mit anderen Worten nicht nur die Verweigerung der Liebe, sondern ein Angriff auf das Wesen der menschlichen Wesen.
Im Rest von Liebe und Augustinus untersucht Arendt Augustinus‘ Hierarchie der Liebe, die psychologische Struktur des Verlangens, die Gefahren der Erwartung und die Bausteine jener „Liebe zur Welt“, die für ein harmonisches Leben und eine harmonische Gesellschaft so wichtig ist. Kombiniere dies mit Elizabeth Barrett Browning über Glück als moralische Verpflichtung und besuche dann erneut Arendts Überlegungen zu Handlung und Streben nach Glück, Lügen in der Politik, die Macht des Außenseiters und den Unterschied zwischen der Art und Weise, wie Kunst und Wissenschaft die menschliche Bedingung erleuchten.
Quellen:
- Hannah Arendt, Liebe und Augustinus
- Augustinus, Bekenntnisse
- Epiktet, Handbuch der Moral
- W.H. Auden, If equal affection cannot be