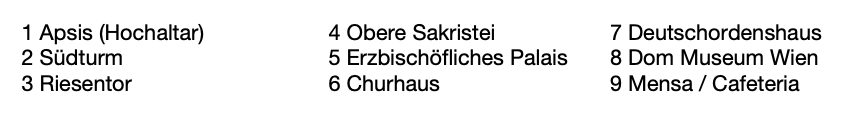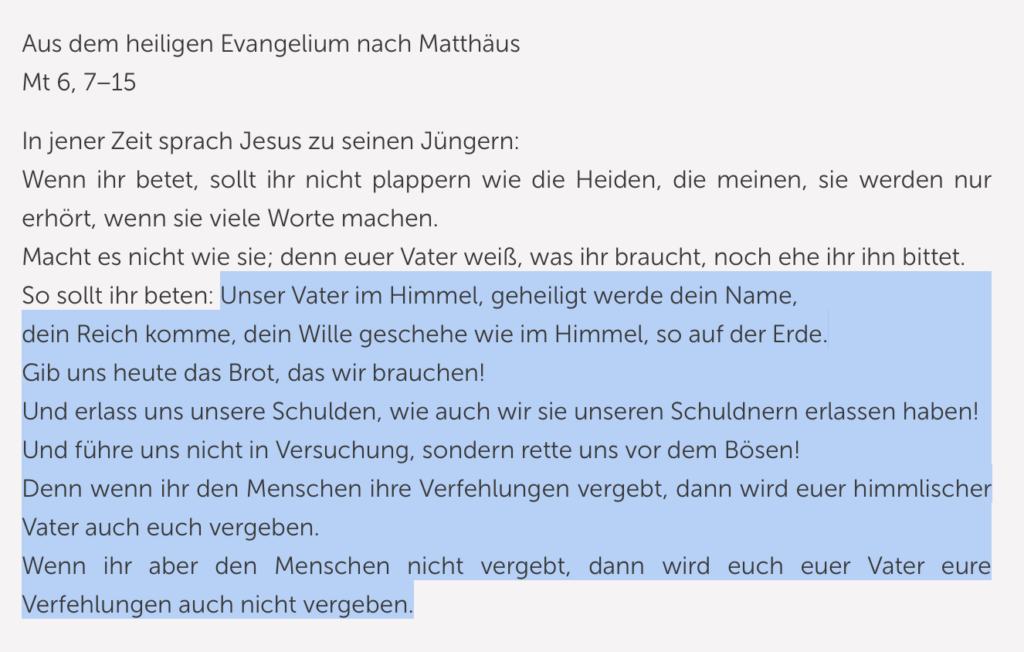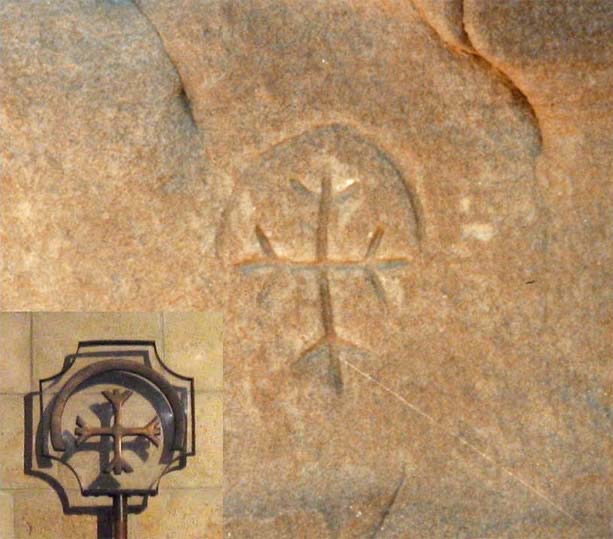Homilie von Probst von Herzogenburg Petrus Stockinger Can. Reg. am Benediktusfest, 21. März 2025 gehalten in Stift Göttweig
In unserer heutigen Welt scheint der Tod oft verdrängt, das christliche Verständnis von Leben und Sterben verloren gegangen. Gerade angesichts der aktuellen Diskussionen um die Gesundheit von Papst Franziskus wird deutlich, wie fremd vielen Menschen der Gedanke geworden ist, dass der Tod nicht das Ende, sondern ein Heimgang ist.

Propst Petrus Stockinger Can. Reg. (* 11. Juli 1982 in Ried im Innkreis, Oberösterreich) ist seit dem 9. April 2019 der 69. Propst des Stiftes Herzogenburg.
Foto: Weinfranz/Stift Herzogenburg
Am Fest des Heimgangs des heiligen Benedikt hat Propst Petrus Stockinger Can. Reg. im Stift Göttweig eine Homilie gehalten, die sich eindrucksvoll und klar mit dieser Frage auseinandersetzt. In einer Zeit, in der Sterben und Tod von Unsicherheit und Verdrängung geprägt sind, lädt uns diese Predigt ein, neu über den letzten Sinn unseres Lebens und über unsere christliche Hoffnung nachzudenken.
Hier veröffentliche ich den vollständigen Text dieser Homilie – ein starker geistlicher Impuls und eine Einladung, das Thema Tod mit Hoffnung und Glauben zu betrachten. Ich habe mich bemüht, die Predigt vollständig und richtig zu transkribieren. Das Original ist mit dem Link am Ende des Textes nachhörbar.
Hochwürdigster Abt Patrick, liebe Mitbrüder des Stiftes Göttweig, liebe Schwestern und Brüder,
Die Berichterstattung, die der gegenwärtige Krankenhausaufenthalt von Papst Franziskus erfährt, ist grotesk. Sie offenbart nach meinem Dafürhalten mit bestechender Klarheit, wie sehr das christliche Verständnis von Leben und Sterben in unserer Welt geschwunden ist.
Da ist zuerst einmal die Tatsache zu vermerken, dass Papst Franziskus 88 Jahre alt ist und an etlichen Vorerkrankungen leidet. Selbst wenn er also stirbt, wird man nur schwer davon reden können, er sei plötzlich und unerwartet mitten aus dem Leben gerissen worden. Das aber ist nur eine Nebenbemerkung.
Viel schwerer wiegt die Frage: Ist denn der Tod für jeden Menschen, also auch für den Papst, wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann? Fast scheint es so, und für viele Menschen ist es so. Wenn nach diesem Leben hier auf der Welt alles vorbei ist, dann ist der Tod eine Katastrophe.
Das wird auch nicht besser, wenn man sich, wie das heute viele Menschen tun, mit jenem unsäglichen Spruch zu trösten versucht, den man heute auf so vielen Toten- und Sterbebildchen lesen muss à la: „In unseren Herzen lebst du weiter.“ Dieser Satz ist an Fragwürdigkeit nicht zu überbieten, denn er bedeutet ja ein scheibchenweises Sterben. Wenn der letzte Mensch gestorben ist, der dich noch gekannt und geliebt hat, dann bist du wirklich tot, mausetot.
Der Spruch suggeriert also nur Ewigkeit, ist aber letztlich Betrug, meist wenig durchdachter Selbstbetrug, um der Emotion willen.
Der Tod ist nicht das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Diese genuin christliche Überzeugung wird hochgehalten am heutigen Fest, das die Benediktiner begehen. Es heißt: Heimgang des Heiligen Vaters Benedikt.
Heimgehen kann man nur an einen Ort, den man schon kennt. Heimfinden wird man nur, wenn man ein Ziel hat. Und von Heimgang kann man auch nur reden, wenn man eine Sehnsucht danach hat, genau dorthin zu kommen. Also: keine Heimat ohne Himmel. All das gehört zur christlichen Sicht auf den Tod dazu. Es trifft jeden Menschen, der getauft ist, bis hin zum Papst, ist aber im allgemeinen Bewusstsein anscheinend weitestgehend verloren gegangen.
Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist nicht sein Tod, sondern das Schlimmste ist wohl, in der entscheidenden Stunde feststellen zu müssen, dass man an Gott vorbeigelebt, den Sinn des Lebens verfehlt, das letzte Ziel, die ewige Heimat, nicht mit ausreichender Ernsthaftigkeit in den Blick genommen hat.
Das ist aus meiner Sicht der springende Punkt. Eine Welt, die verlernt hat, im Leben nach dem Sinn zu fragen und diesen allerletzten Sinn zu suchen – und zwar nicht als Lifestyle-Element, sondern als lebensprägenden Faktor –, kann auch den Tod nicht mehr richtig einordnen. Die Verwirrung im Leben führt auch zu einer Verwirrung im Sterben.
Und kristallisiert sichtbar wird das in diesen Tagen – und das ist eben grotesk – ausgerechnet an der Person des Papstes.
Wir wissen nicht, wie sich sein Lebensende einmal gestalten wird. Er weiß es selbst auch nicht. Niemand kennt den Tag noch die Stunde. Wir wissen nicht: Wird es ein öffentlich zelebriertes Sterben, wie bei Johannes Paul II., oder wird es ein Verlöschen in Stille, wie bei Papst Benedikt? Es geht uns letztlich auch nichts an.
Ich muss sagen: Wenngleich die Medien den derzeit an den Tag gelegten offenen Umgang der vatikanischen Stellen mit dem Gesundheitszustand des Papstes loben – mir ist das zu viel. Mir ist das zu öffentlich. Ich stelle da schon auch die Frage nach der Privatsphäre und letztlich nach der Würde, die man auch einer öffentlichen Person wie dem Papst in einer so persönlichen Lebensphase zugesteht.
Auch diverse Äußerungen mancher (römischer) Kleriker helfen da nichts. Selbst der undifferenzierte Aufruf zum Gebet ist etwas zweifelhaft. Wofür sollen wir denn beten? Dass der Papst bitte, bitte, bitte nicht sterben wolle? Das kommt mir lächerlich vor. Denn diesen Weg einmal gehen zu müssen, entspricht seiner menschlichen Natur.
Wenn uns in einer solchen Situation irgendein Gebet erlaubt, ja geboten ist, dann besteht das wohl, wie an jedem Krankenbett, in der Meditation über die Vaterunser-Bitte an den himmlischen Vater: „Dein Wille geschehe.“ Wie auch im Vertrauen auf den Beistand der Gottesmutter: „Jetzt und in der Stunde unseres Todes.“
Vieles andere kann sich rasch als fragwürdig erweisen. Und wir tun darüber hinaus am besten genau das, wozu wir heute zusammengekommen sind. Wir feiern, dass der Tod ein Heimgang ist. Wir halten dem lächerlich-grotesken Umgang unserer Zeit mit diesem Thema Gottes Aufstand aus dem Tod entgegen.
Noch dazu in unmittelbarer Nähe zum Hochfest des Heiligen Josef vor zwei Tagen, der früher oft angerufen wurde als Patron für einen guten – das heißt für einen vorbereiteten – Tod: Versöhnt mit der Welt, versöhnt mit dem eigenen Leben, versöhnt mit Gott.
Ich bin sicher: Papst Franziskus hat diese drei Parameter seines Lebens längst nach bestem Wissen und Gewissen geordnet. Damit kann auch sein Tod, wann immer er kommt, ein Heimgang sein.
Aber ein paar Schritte zurück: Wir gönnen dem Papst das Leben und sind sicher, dass sich in Gottes Plan alles gut fügen wird. Ohne eine billige „Am Ende wird schon alles irgendwie passen“-Hoffnung, wie sie heute nicht selten gepflegt wird. Nein, es ist eine Hoffnung, die begründet ist im Glauben.
Wie sagt Nelly Sachs? „Nur der Glaube kann halten, was die Hoffnung verspricht.“ Nur der Glaube kann halten, was die Hoffnung verspricht.
Überliefert ist: Sechs Tage vor seinem Tod ließ Benedikt sein Grab öffnen. Sechs Tage – das erinnert an die Schöpfungserzählung im Buch Genesis. Der Tod ist ein Ereignis des Lebens, das es in den Blick zu nehmen gilt. Benedikts Leben hatte sich so vollendet, dass er am siebten Tag in die Sabbatruhe Gottes eingehen konnte.
Der Tod ist ein Heimgang.
Nur der Glaube kann halten, was die Hoffnung verspricht.
Amen.
Nelly Sachs (eigentlich Leonie Sachs; geboren am 10. Dezember 1891 in Schöneberg, gestorben am 12. Mai 1970 in Stockholm) war eine deutsch-schwedische jüdische Schriftstellerin und Lyrikerin. 1966 verlieh das Nobelpreiskomitee ihr – gemeinsam mit Samuel Joseph Agnon – den Nobelpreis für Literatur „für ihre hervorragenden lyrischen und dramatischen Werke, die das Schicksal Israels mit ergreifender Stärke interpretieren“.
Nachhörbar ist die Homilie im Originalton auf der Seite von Stift Göttweig. Datum: 21.3.2025.
https://www.stiftgoettweig.at/portal/de/betenarbeiten/seelsorge/predigten