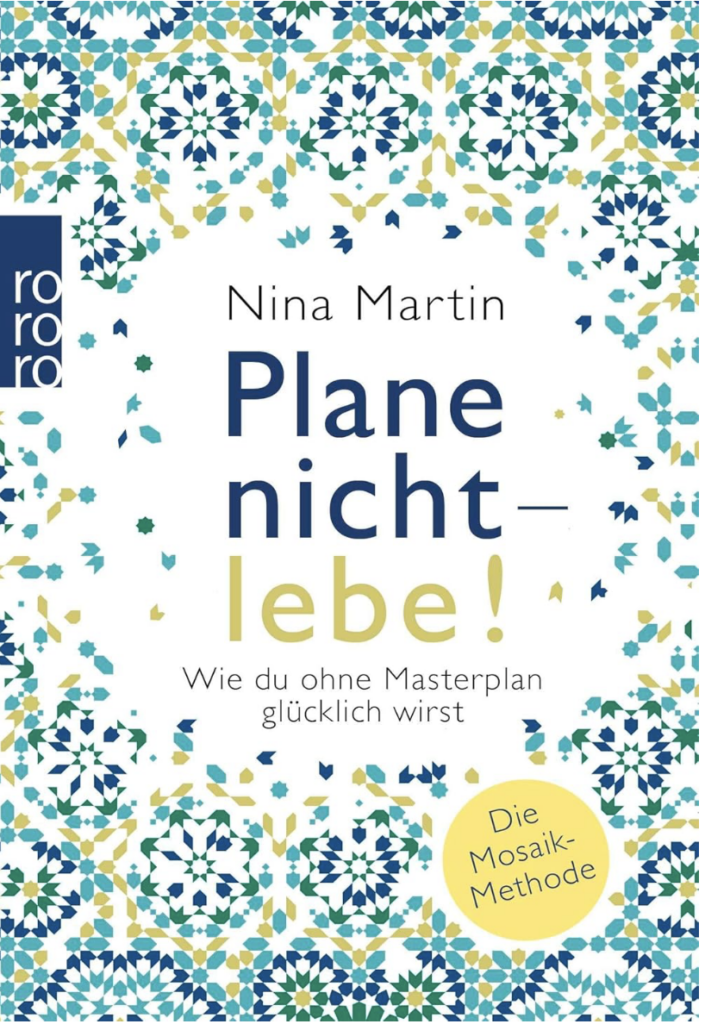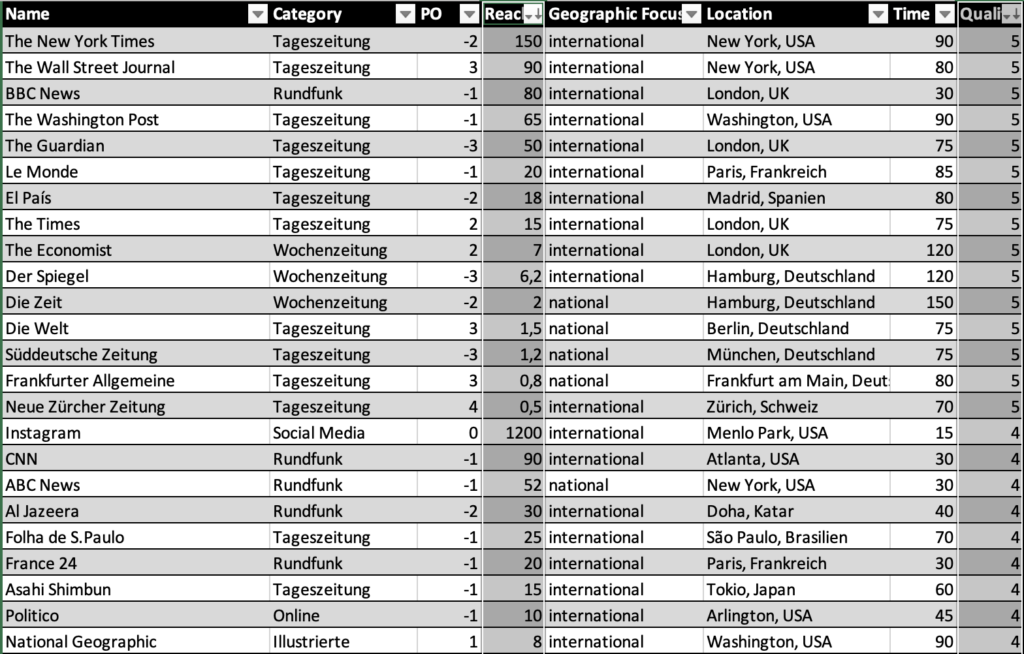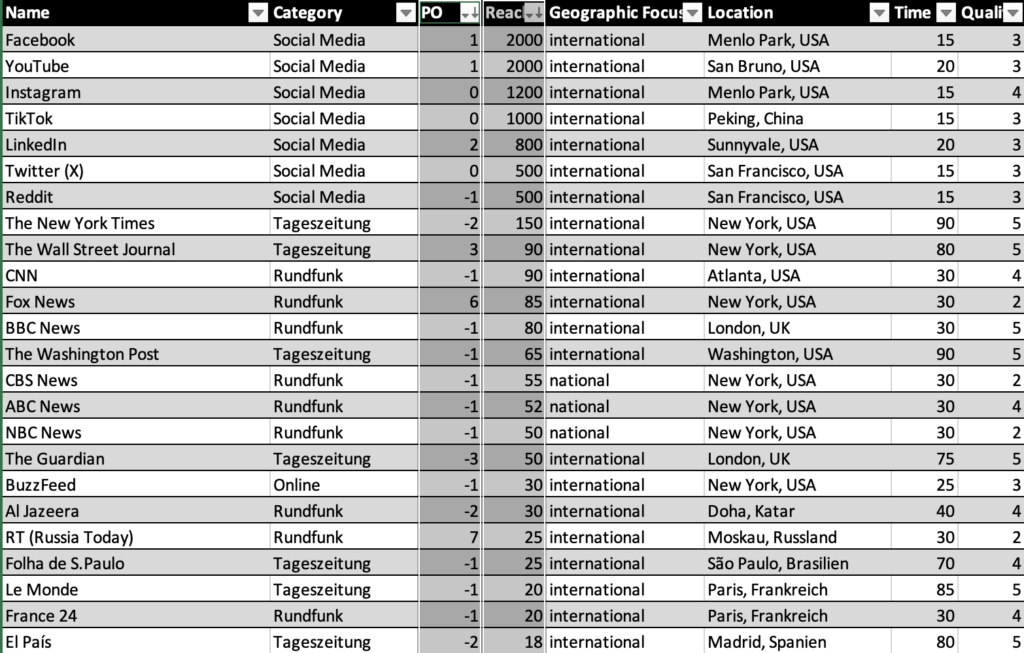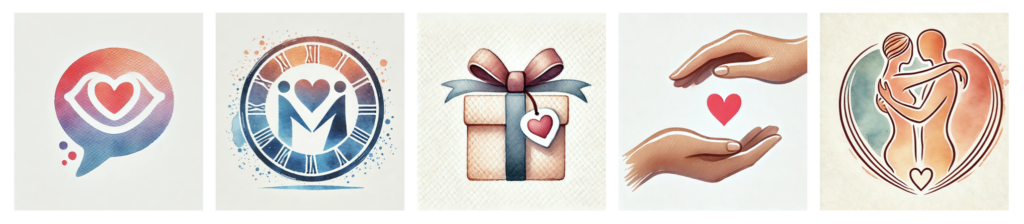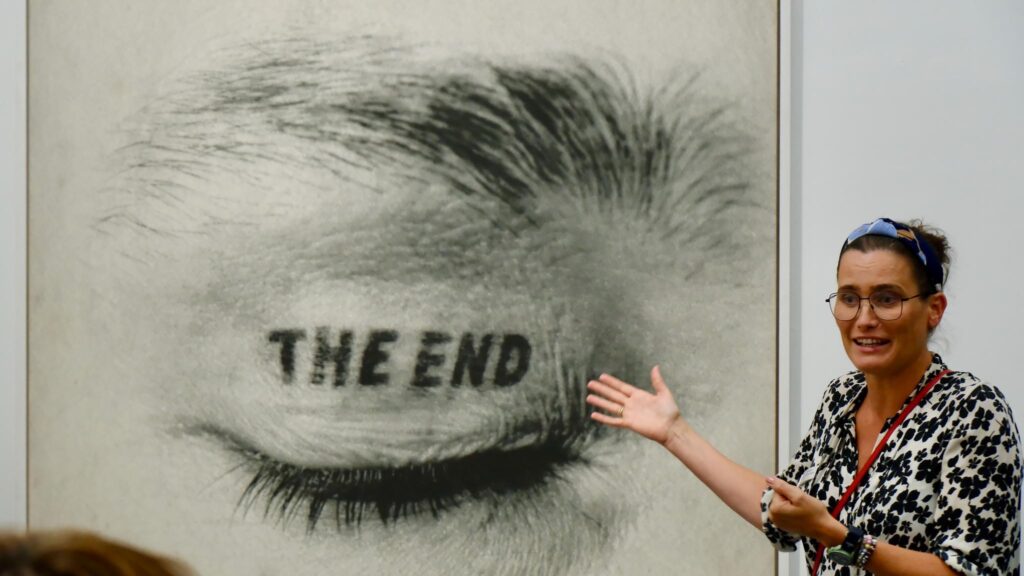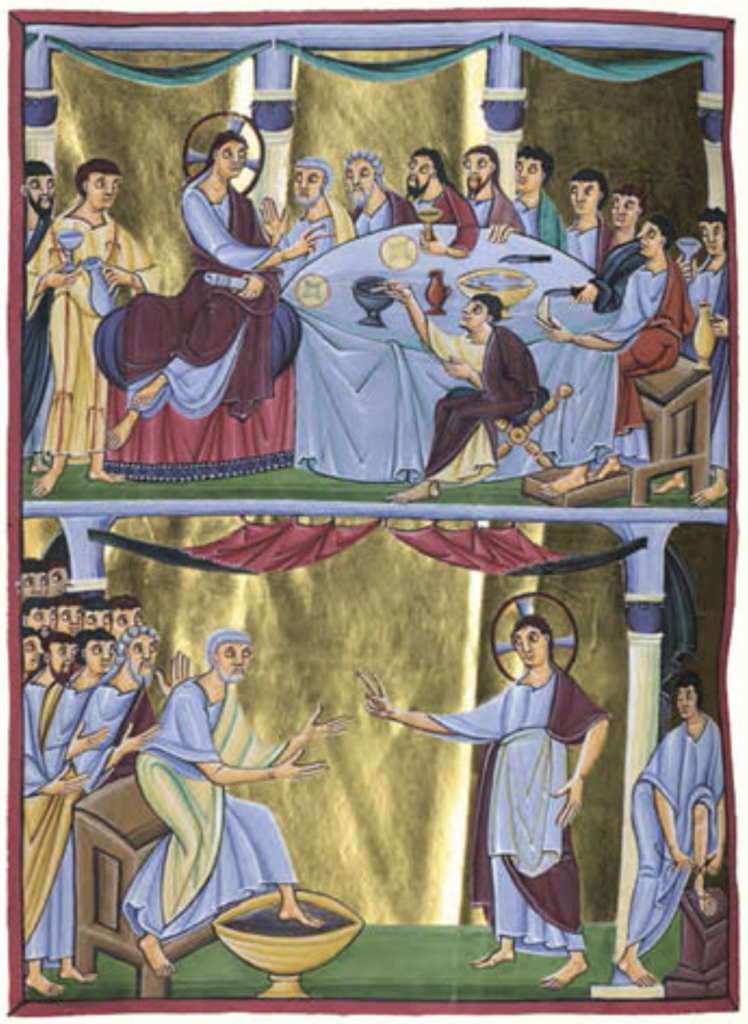Zusammenfassung eines Gesprächs mit Michael Lehofer
14.11.2024 Michael Lehofer beschreibt die zunehmende Zahl an psychischen Krisen und Burnouts als ein Symptom der modernen Arbeitswelt, in der Menschen oft wie Maschinen funktionieren müssen. Obwohl die Arbeitsbedingungen objektiv betrachtet besser geworden sind, führt die implizite Unternehmensphilosophie vieler Betriebe dazu, dass Mitarbeitende als planbare Objekte betrachtet werden. Diese Reduktion auf Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit nimmt den Menschen die Möglichkeit, als Individuen mit eigenen Stärken und Schwächen wahrgenommen zu werden. Lehofer betont, dass Menschen diese Entfremdung von sich selbst und von anderen nicht ertragen können, was die Ursache für innere Krisen und das Gefühl der Überforderung ist.
Zur Lösung dieser Problematik sieht Lehofer die zwischenmenschliche Kommunikation als zentral an. Kommunikation ist der Schlüssel zu einer Kulturveränderung in Unternehmen, weil sich die meisten Verletzungen und Missverständnisse genau hier ereignen. Durch eine echte, persönliche Kommunikation können Mitarbeitende wieder spürbar füreinander werden, was ein Gefühl von Verbindlichkeit und Wärme schaffen kann, das in vielen Organisationen fehlt. Eine gelingende Kommunikation bildet damit die Basis für die Heilung von zwischenmenschlichen Wunden und für die Entstehung eines menschlicheren Arbeitsumfeldes.
Lehofer weist auch darauf hin, dass die gesellschaftliche Wahrnehmung oft trügt. Während viele Menschen das Gefühl haben, die Welt werde immer schlechter, zeigen objektive Daten, dass die Bedingungen sich über die Jahrzehnte stetig verbessert haben. Die subjektive Wahrnehmung verschlechtert sich jedoch, weil Menschen immer höhere Ansprüche an sich selbst stellen und durch den ständigen Vergleich mit anderen in sozialen Medien unter Druck geraten. Anstatt auf persönliche Zufriedenheit und Freude zu achten, jagen viele einem unerreichbaren Ideal hinterher, was zu innerem Unfrieden und Erschöpfung führt.
Abschließend betont Lehofer, dass der Schlüssel zum Glücklichsein nicht in einem bestimmten Ziel oder einem erfüllten Wunsch liegt, sondern in der Fähigkeit, das Glücklichsein selbst zu leben. In den Worten von Buddha: „Es gibt keinen Weg zum Glücklichsein. Glücklichsein ist der Weg.“ Dieser Ansatz fordert dazu auf, sich selbst anzunehmen und Frieden in der Gegenwart zu finden, anstatt ständig dem „besseren Leben“ nachzujagen. Glück bedeutet somit nicht, etwas zu erreichen, sondern sich in den Alltagserfahrungen wiederzufinden und Freude an den kleinen Momenten zu haben.
Michael Lehofer ist ärztlicher Direktor des LKH Graz II und leitet die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 1.
Quelle: https://youtu.be/HSf5sNB_z8Y